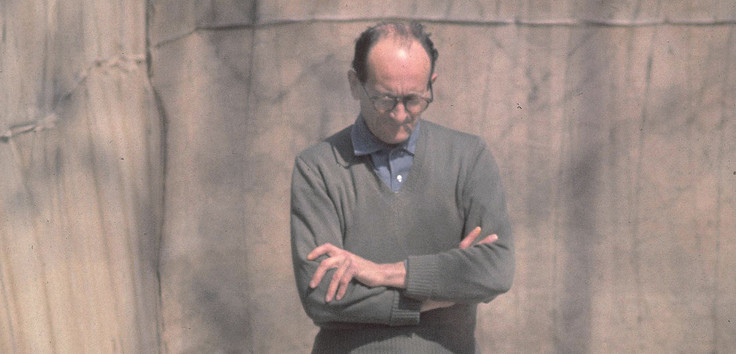Am 11. April 1961 begann in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann. Er war einer der Planer des Holocaust, der im Reichssicherheitshauptamt in Berlin die Vertreibung und Deportation von Millionen Juden in die Vernichtungslager organisiert hatte. 1946 war er aus US-Kriegsgefangenschaft geflohen, versteckte sich einige Monate auf einem Bauernhof und lebte dann in der britischen Besatzungszone unter falschem Namen.
Wie vielen anderen NS-Verbrechern wurde ihm 1950 durch die Katholische Kirche ein „Ablasszertifikat“ ausgestellt, mit dessen Hilfe er unter dem Namen Ricardo Klement heimlich über Italien nach Argentinien gelangen konnte, die sogenannte Rattenlinie. Eine Fluchtroute für hochrangige NS-Vertreter. Der israelische Geheimdienst kidnappte den ehemaligen SS-Obersturmbannführer, dessen Aufenthaltsort in
Argentinien sowohl dem Bundesnachrichtendienst als auch der CIA seit Jahren bekannt war, im Mai 1960. Weil die Bundesrepublik Deutschland kein Auslieferungsersuchen stellte, wurde Eichmann nach israelischem Recht angeklagt. Der Prozess endete im Dezember 1961 mit seiner Verurteilung zum Tode wegen Verbrechen gegen die Menschheit, begangen an Angehörigen des jüdischen Volkes. Am 31. Mai 1962 wurde Adolf Eichmann hingerichtet.
Kein Rädchen im Getriebe
Im Mittelpunkt des Prozesses stand – anders als bei den Nürnberger Prozessen gegen die Hauptkriegsverbrecher 1945 – der Genozid an den Juden. Im Gegensatz zu den wenigen bis dahin in Westdeutschland durchgeführten Verfahren wegen Verbrechen gegen Juden ging es hier nicht so sehr um einzelne Taten, sondern um den gesamten Holocaust. Eichmann versuchte, sich selbst vor Gericht als jemand darzustellen, der nur Befehle ausgeführt habe, ein „Rädchen im Getriebe“ und als solches nicht schuldig zu sprechen sei.
Doch Adolf Eichmann war alles andere als ein kleiner Helfer. Als Leiter des „Judenreferats“ im Reichssicherheitshauptamt war er verantwortlich für die Planung und Durchführung des Völkermords an den europäischen Juden. Mit Einfallsreichtum und Schläue betrieb er das wirkmächtig und engagiert. Als Beispiel ein Detail, das durch Zeugenaussagen im Jerusalemer Prozess belegt wurde: Eichmann hatte sich ausgedacht, dass ungarische Juden vor ihrem Gang in die Gaskammern an ihre Freunde und Verwandte beruhigende Postkarten schreiben sollten: „Wir sind an einem wunderbaren Ausflugsort an einem Waldsee. Es ist aber nicht mehr viel Platz. Kommt deshalb schnell. Bringt gute Schuhe mit.“
Die jüdische Politikwissenschaftlerin Hannah Ahrendt – im Nazideutschland vor der Verfolgung nach Amerika emigriert – stellte als Prozessbeobachterin die berühmte wie umstrittene These von der „Banalität des Bösen“ auf. Damit wollte Ahrendt keineswegs die Verantwortlichkeit Eichmanns mindern oder seine Verbrechen verharmlosen. Sie wollte im Gegenteil die Alltäglichkeit, die Gewöhnlichkeit („banality“) des Bösen zeigen, das vom System des Nationalsozialismus in „normalen“ Menschen hervorgebracht wurde. Damit widersprach Ahrendt der – damals in Bezug auf den Nationalsozialismus üblichen – Deutung des Bösen als dämonisch oder teuflisch, als eine höhere Macht, die Menschen überfallen habe. Ahrendt meinte vielmehr, das Beispiel Eichmann zeige, dass jeder und jede zum Täter werden konnte. Für Arendt war Eichmann ein Teil in der Vernichtungsmaschinerie, ein gehorsamer Beamter am Schreibtisch, ein typischer Funktionär ohne Schuldbewusstsein oder -erkenntnis, der ohne besonderen Hass agierte, sondern einfach dazugehören und Karriere machen wollte.
Gefühllos vor Gericht
Eichmann selbst inszenierte sich im Prozess als Biedermann. Der frühere israelische Staatsanwalt Gabriel Bach berichtete später in einem Zeitzeugengespräch, dass er im Verhör bei Eichmann nach Gefühlen der Reue gesucht habe oder angesichts der vorgeführten Grausamkeit erwartete wenigstens eine Gemütsbewegung zu sehen. Stets aber lauschte dieser eher teilnahmslos den grauenvollen Berichten der Zeugen über die Details der Verbrechen, die an ihnen und ihren Familien begangen wurden und die auch belegten, dass Eichmann durchaus „vor Ort“ in den Lagern war und sich vom Funktionieren der Todesmaschinerie überzeugt, seine Tätigkeit sich also keineswegs auf den Berliner Schreibtisch beschränkt hatte. Die einzige Gemütsregung – so Staatsanwalt Gabriel Bach – zeigte Eichmann einmal, als er merkte, dass er seine Krawatte in der Zelle vergessen hatte. Das war ihm sehr wichtig, dass er stets bürgerlich gekleidet im Gerichtssaal auftreten konnte.
Protestantische Perspektiven
Der Berliner evangelische Propst Heinrich Grüber, der in der Nazizeit vielen Christ*innen geholfen hatte, die nach damaliger „Rasse“-Definition als Juden galten, hatte die Ehre, als Kirchenmann in Jerusalem als Zeuge gehört zu werden. Er sagte über seine früheren Begegnungen mit Eichmann aus: „(…) Ich habe von ihm den Eindruck eines Mannes gehabt, der da sitzt wie ein Eisblock (…) und alles, was man versucht, an ihn heranzubringen (zum Beispiel Vorschläge für die Ausreise einiger Bedrohter), das prallt ab (…). Er ist so etwas, was wir damals den ‚Landsknechts-Typ‘ nannten: (…) der mit seiner Uniform, die er anzieht, das Gewissen und den Verstand ablegt.“
Aber es gab auch andere evangelische „Zeugnisse“, die Eichmann zu verteidigen suchten. So ergriff der ehemalige oberösterreichische Superintendent Wilhelm Mensing-Braun, der Eichmann aus seiner Zeit als Pfarrer in Linz kannte, beim kirchlichen Außenamt in Frankfurt am Main im Juni 1960 für Eichmann Partei: „Charakterlich war er (…) von grundanständiger Gesinnung und ein Mann mit gütigem Herzen und großer Hilfsbereitschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er je zu Grausamkeit oder verbrecherischen Handlungen fähig gewesen wäre.“
Zur Bedeutung des Eichmann-Prozesses in Israel sagte der Staatsanwalt Gabriel Bach: „Durch den Prozess ist das Gedenken an den Holocaust enorm gestiegen. Damals wollten viele Zeugen nicht aussagen. Sie wollten das Geschehene verdrängen.“ Auch in Deutschland weigerten sich viele – aus Perspektive der Täter – über den Nationalsozialismus und seine Verbrechen zu reden, lehnten es zum Beispiel ab, ihn in der Schule zu thematisieren. Weil aber über den Prozess jeden Tag berichtet wurde, war das Verschweigen nicht mehr möglich. So stand, wenigstens für kurze Zeit, der Holocaust im Mittelpunkt internationaler Aufmerksamkeit. In der Bundesrepublik wuchs durch ihn auch das Interesse an anderen Nazi-Tätern. So wurden durch den Eichmann-Prozess später auch die Frankfurter Ausschwitzprozesse möglich und die Verjährungsregeln für Naziverbrechen gelockert.
Marion Gardei ist Beauftragte für Erinnerungskultur in der EKBO und seit Januar landeskirchliche Antisemitismusbeauftragte. Der christlich- jüdische Dialog ist ein Schwerpunkt ihrer Arbeit.